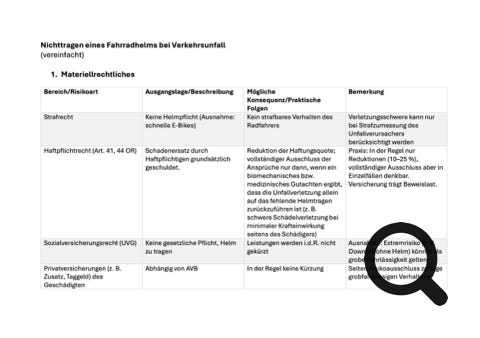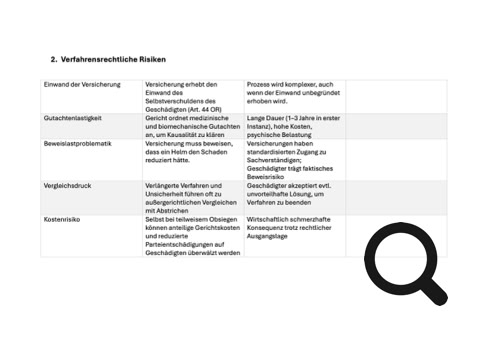22/11/2025
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam tincidunt lorem enim, eget fringilla turpis congue vitae. Phasellus aliquam nisi ut lorem vestibulum eleifend. Nulla ut arcu non nisi congue venenatis vitae ut ante. Nam iaculis sem nec ultrices dapibus. Phasellus eu ultrices turpis. Vivamus non mollis lacus, non ullamcorper nisl. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Phasellus sit amet scelerisque ipsum. Morbi nulla dolor, adipiscing non convallis rhoncus, ornare sed risus.
Sed adipiscing eget nibh at convallis. Curabitur eu gravida mauris, sit amet dictum metus. Sed a elementum arcu. Proin consectetur eros vitae odio sagittis, vitae dignissim justo sollicitudin. Phasellus non varius lacus, aliquet feugiat mauris. Phasellus fringilla commodo sem vel pellentesque. Ut porttitor tincidunt risus a pharetra. Cras nec vestibulum massa. Mauris sagittis leo a libero convallis accumsan. Aenean ut mollis ipsum. Donec aliquam egestas convallis. Fusce dapibus, neque sed mattis consectetur, erat nibh vulputate sapien, ac accumsan arcu sem quis nibh. Etiam et mi sed mauris commodo tristique. Proin mollis elementum purus, a porta quam vehicula et.
Quisque ullamcorper, sapien ut egestas faucibus, tortor mauris tempor odio, sed pretium risus dui sit amet lectus. Sed ligula mi, tincidunt nec porttitor vel, aliquet sit amet libero. Nulla sagittis ultricies sem, non pretium augue bibendum vitae. Nunc luctus tristique urna eu tincidunt. Etiam ultricies neque ante, ut placerat dolor iaculis dapibus. Curabitur luctus orci et gravida laoreet. Sed ultrices id nulla id mollis. Donec tempor dapibus sem, a convallis felis elementum sed. Aenean nisi tortor, dictum ac massa non, rhoncus sagittis leo. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Proin id justo sit amet mi euismod lobortis. Morbi at mauris condimentum, vestibulum risus eu, laoreet elit. Aenean posuere risus vel hendrerit dignissim. In leo tellus, feugiat sit amet purus laoreet, consequat tincidunt orci. Integer sit amet justo in mi rhoncus commodo. Duis sagittis augue nisi, in fringilla tortor iaculis id.
Aenean luctus sodales tempus. Sed tincidunt nisl in nisl congue, at facilisis lorem posuere. Donec id erat vel lectus volutpat pellentesque a quis magna. Praesent bibendum orci in lobortis porta. Suspendisse eget odio a ligula ornare mollis. Maecenas eleifend urna ac feugiat posuere. Donec turpis ipsum, rhoncus eu laoreet eu, viverra tristique urna. Aliquam euismod velit mi, et pharetra libero gravida vitae. Praesent ligula lorem, hendrerit ut laoreet a, porta ut diam. Cras tellus lacus, mattis quis rhoncus id, interdum eget mi. Sed ac aliquet ligula, suscipit malesuada dui. Fusce eu nibh eget diam aliquet feugiat. Nam orci neque, volutpat ac metus id, fermentum tristique sapien. Phasellus ac ultricies risus.
Aenean vitae blandit nibh. Vestibulum a justo non lorem malesuada commodo. Suspendisse ac mi sit amet neque molestie interdum in at eros. Proin ac suscipit arcu, non suscipit felis. Donec accumsan, quam non pulvinar venenatis, sapien
Basel-Stadt und die Erosion staatlicher Resilienz
1. Paradox einer erfolgreichen, aber strukturell belasteten Stadt
Basel-Stadt ist wirtschaftlich stark, kulturell bedeutend, international vernetzt und verfügt über eine hochqualifizierte Bevölkerung. Gleichzeitig zeichnet sich der Stadtkanton zunehmend durch eine politische und administrative Struktur aus, die auf Überdehnung, Fragmentierung, Überregulierung und nachlassende Selbstkorrekturfähigkeit hindeutet.
Der kürzlich erschienene Zeitungsartikel „Der Staat ist keine Erziehungsanstalt“ hat dieses Spannungsfeld sichtbar gemacht. Die dort kritisierte Tendenz des Kantons, bis tief in persönliche Lebensführung und Alltagsorganisation hineinzuregieren, ist kein isoliertes Phänomen, sondern Symptom einer umfassenderen Problematik: Basel mangelt es an institutioneller Resilienz.
Strukturelle Trendlinien
2. Überregulierung als Ausdruck politisch-administrativer Ermüdung
2.1. Die Logik des „Erziehungsstaates“
Der kantonale Gesetzgeber und die Verwaltung greifen zunehmend in Bereiche ein, die traditionell privater oder gesellschaftlicher Selbstorganisation vorbehalten sind:
• Mobilitätsverhalten
• Alltagsgewohnheiten
• Nutzung des öffentlichen Raums
• Erziehungs- und Bildungsfragen
• ökologisch motivierte Verhaltensnormen
Dieser Trend folgt einer bekannten verwaltungssoziologischen Gesetzmässigkeit: Je geringer die staatliche Wirkungskraft in Kernaufgaben ist, desto stärker wird symbolisch und mikroregulativ gesteuert. Symbolpolitik ersetzt Funktionspolitik.
2.2. Die administrative Überdehnung
Basel produziert Dossiers, Strategien, Roadmaps und Programme in einer bemerkenswerten Kadenz. Die Folge:
• Verdichtung der Bürokratie
• steigende Administrativkosten
• abnehmende Umsetzungsgeschwindigkeit
• zunehmende Unübersichtlichkeit für Bevölkerung und Institutionen
Die Vielzahl parallel laufender Programme führt zu einem Zustand, den die Verwaltungswissenschaft als „self-induced complexity“ bezeichnet: Die Verwaltung erschwert sich die Erfüllung ihrer Kernaufgaben durch selbst geschaffene Komplexität.
3. Fehlende Prioritätensetzung
Basel verliert zunehmend die Fähigkeit, klare Prioritäten zu setzen.
3.1. Sicherheitspolitische Defizite
Bereits seit Jahren zeigen sich strukturelle Schwächen:
• niedrige Präsenz sichtbarer Ordnungskräfte
• zögerliche Intervention bei einschlägigen Brennpunkten
• fehlende Stringenz in der Durchsetzung des Polizeirechts
• politisch motivierte Zurückhaltung gegenüber sicherheitspolitischen Investitionen
3.2. Verkehrspolitische Überlagerung durch Ideologie
Basel verfügt über:
• eine Vielzahl unverknüpfter Verkehrsregime,
• divergierende Zielsetzungen von Verwaltung, Parlament und Zivilgesellschaft,
• Versuche, Verhaltensmuster statt Verkehrsströme zu steuern.
Das Resultat ist hohe politische Energie – niedriger strategischer Output.
3.3. Stadtentwicklung ohne kohärentes Leitbild
Wesentliche Trends wie Verdichtung, Nutzungskonflikte, sozialräumliche Durchmischung oder der Einfluss grenzüberschreitender Mobilität werden fragmentarisch behandelt. Es fehlt:
• ein integriertes strategisches Leitbild,
• ein kohärentes stadtregional abgestimmtes Vorgehen (mit Basel-Land, Südbaden, Elsass),
• eine Priorisierung im Spannungsfeld zwischen Wohnungsbau, Sicherheit und Infrastruktur.
4. Der Wandel der politischen Kultur – von der Aushandlung zur Moralisierung
4.1. Verlust der pragmatischen Mitte
In früheren Jahrzehnten war Basel geprägt von einer politisch breit getragenen Pragmatik. Diese ist zunehmend durch identitätspolitische Konfliktlinien ersetzt worden:
• ökologisch-normative Politik vs. wirtschaftsorientierte Pragmatik
• symbolpolitische Mobilisierung vs. operative Umsetzung
• identitätsbasierte Debatten vs. Problemlösungsorientierung
4.2. Folgen für den politischen Betrieb
Dies führt zu:
• verlängerten politischen Entscheidungswegen,
• einer Emotionalisierung normaler Verwaltungsthemen,
• Misstrauen gegenüber departements- und amtsübergreifender Kooperation,
• zunehmenden Legitimationskonflikten.
In der Politikwissenschaft gilt: Je stärker Politik moralisiert, desto schwächer wird ihre Governance-Leistungsfähigkeit.
5. Fragmentierte Verwaltung und unklare Verantwortlichkeiten
5.1. Strukturelle Parzellierung
Basels Verwaltungsarchitektur ist stark segmentiert:
• sieben Departemente mit divergierenden politischen Leitbildern
• ausgeprägte politische Loyalitätskulturen
• historisch gewachsene Amtsstrukturen
• parallele Aufgabenerledigung ohne klare „Lead“-Funktion
5.2. Folgen für die Stadt
Fragmentierung führt zu:
• unklaren Verantwortlichkeiten,
• langwierigen Abstimmungsprozessen,
• redundanten Projektstrukturen,
• einer Zunahme „überorganisierter Ineffizienz“.
Das System produziert mehr Regeln, aber weniger Wirkung.
Die Erosion der institutionellen Resilienz
6. Fehlende Selbstkorrekturmechanismen
Resiliente Gemeinwesen erkennen Fehlentwicklungen frühzeitig und korrigieren sie entschlossen. Basel hingegen zeigt eine systematische Schwäche in vier Punkten:
6.1. Verzögerte Problemerkennung
Viele Langzeitprobleme – Sicherheit, öffentlicher Raum, Verkehr, Littering – werden oft erst anerkannt, wenn das Problem bereits manifest ist.
6.2. Zögerliche Reaktion
Wenn Korrekturen erfolgen, dann:
• inkrementell,
• spät,
• ohne verbindliche Zielsetzungen,
• mit hohem internen Abstimmungsaufwand.
6.3. Fehlende Durchsetzungskultur
Basel zeigt eine administrative Zurückhaltung, die aus Sorge vor Polarisierung resultiert. Die Verwaltung verhält sich konfliktvermeidend – ein Risiko in komplexen urbanen Räumen.
6.4. Geringe institutionelle Lernfähigkeit
Projekte werden selten systematisch evaluiert. Fehlentscheidungen laufen aus, statt korrigiert zu werden. Erfolgreiche Pilotversuche werden oft nicht skaliert.
Gesamtbild
7. Das Muster der strukturellen Erschöpfung
Basel-Stadt befindet sich in einem Zustand administrativer Überdehnung und politischer Selbstblockade.
Die wichtigsten Symptome:
1. Übersteigerte Regulierungsansprüche
2. Rückzug aus Kernaufgaben
3. Moralisieren der politischen Kultur
4. Fragmentierte Verwaltung
5. Verlust institutioneller Lernfähigkeit
6. Nachlassende Resilienz in Sicherheit, Infrastruktur und Governance